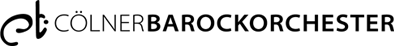Insbesondere jetzt an Ostern und der davor durchlebten Passionszeit wäre Musik an vielen Orten erklungen: Passionen, Lamentationes, Klagegesänge oder nun an Ostern schließlich Oratorien, Messen, Motetten, Kantaten. In diesem Jahr blieben diese Konzerte aus und ich frage mich: Wo ist all diese Musik, die nicht gespielt wurde, Klänge, die nicht erklungen sind, Kompositionen, die nicht geprobt und aufgeführt wurden?
Natürlich haben wir jede dieser Musiken digital oder manifestiert in CDs, LPs o.ä. verfügbar. Diese bereits eingespielten Aufnahmen werden nun dargeboten und geben uns die Möglichkeit die Musik hörend mitzuempfinden.
Aber was ist mit den Klängen, die nicht aus den Körpern, Köpfen und Seelen von Musikerinnen und Musikern heraustönen konnten und können? Wo stecken die Passionen, die wir nicht gespielt haben? Wie oft wäre der „Vorhang im Tempel zerrissen“, das „süße Kreuz“ beweint oder „Jesu selbst begraben“ worden? Selten habe ich die Anwesenheit der Abwesenheit so sehr gespürt, wie in diesen Wochen ohne Passionen, ohne gemeinsame Proben und Konzerte. Lagert sich die Anwesenheit des Nichtgespielten irgendwo ab? Wie Kalk in den Rohren?
Auch wenn wir vieles von diesen Werken ‚im Schlaf’ spielen können, sie hundert Mal ‚abgeliefert’ haben, passiert doch jedes Mal etwas Neues mit uns. Und dafür müssen wir nicht einmal religiös sein oder die Leidensgeschichte und die der Auferstehung Christi performativ erleben wollen. Jedes gemeinsame Spielen – und das erfahre ich als Cellistin im CBO sehr intensiv – produziert nicht nur etwas, wie eben z.B. Klänge nach bestimmten Vorgaben (also z.B. Noten auf dem Papier, die zum Klingen gebracht werden). Viel eher und grundständiger treten wir als Ensemble miteinander in Kontakt noch bevor ein Ton erklingt. Das Zusammenkommen zum Spielen, zum Proben und Aufführen hat also nicht nur eine produktive (und damit natürlich auch ökonomische) Relevanz, sondern auch eine anthropologische.
Wir spielen uns zu Menschen, ganz gleich welcher Art! (Ja? Tun wir das?) Das heißt in unserer intersubjektiven Auseinandersetzung und durch das bloße Zusammen-Sein, Beieinander-Sein und im Vorbereiten und Durchleben eines Ziels, z.B. einer Passionsaufführung verändern wir uns selbst.
Klänge fließen beim Musikmachen nicht nur durch unsere Körper hindurch wie Wasser durch einen Durchlauferhitzer. Wir beanspruchen für uns eine ‚eigene Stimme’, einen bestimmten CBO-Klang, eine Stimmung und Atmosphäre, von der wir hoffen, sie sei einzigartig. Musik wird also durch uns (unser intersubjektives körperliches Aushandeln) auf bestimmte Art und Weise geformt. Spiegeln wir diese Annahme zurück, bedeutet dies: Im Musikmachen erleben wir unsere menschliche Einzigartigkeit, unsere Emotionen, wir erleben Empathie, und ja, sicherlich erleben wir auch Konflikte, Fragen, Krankheit und unsere eigenen Grenzen.
Verkümmern diese Gefühle und unser in der Musik hergestelltes Menschsein mitsamt der nichtgespielten Musik? Wenn dies nicht der Fall ist, welche Bahnen suchen wir uns? Wie viel gedachte, d.h. mental vorgestellte Gemeinsamkeit als Orchester ist möglich? Und was macht das auf mich allein Zurückgeworfen-Sein in der akuten Situation mit mir?
Den von Faust so innig beschriebenen Auftrag des Frühlings, Bildung (im Sinne von ‚etwas Neues schaffen’) und Streben anzuregen, den können wir als CBO gerade nicht einlösen, und ja, das vermisse ich wirklich sehr. Im Musikmachen bin ich menschlich. Dort spüre und fühle ich mich. Das fehlt mir ebenso.
Fragmentarisches und Unerreichtes neu und ganz zu entdecken ist sicherlich eine Bahn, die ich einschlage und die meinen Osterstein ins Rollen bringt.